In diesem Blog vergleichen wir die wärmespeichernde Wirkung konventioneller und erneuerbarer Dämmstoffe.
Konventionelle und nachwachsende Dämmstoffe
Inhalt:
- Pflicht zur wird energetischen Sanierung
- Bauphysikalische Eigenschaften der Wärmedämmung
- Konventioneller Dämmstoff
- Nachwachsende Rohstoffe
- Dämmen oder Heizen?
Dämmstoffe erfüllen in Wohnungsbau unterschiedliche Anforderungen. Sie dienen zur Wärmeisolierung und können zur Minderung von Tritt- und Körperschall eingesetzt werden. Seit der europäischen Forderung nach effizientem Bauen, rückt der Energiebedarf für Produktion und Entsorgung der Isolierung in den Fokus. Ökologisch abbaubare Materialien gewinnen an Zuwachs, zumal ihre Dämm-Eigenschaften gut sind.
Pflicht zur wird energetischen Sanierung
Seit EnEV Energiesparverordnung 2014 wird für Neubauten und Sanierung von Altbauflächen (bei über 10% der Gesamtfläche) die Dämmpflicht geltend. Dies kommt dem Klimaschutz zugute und stärkt nebenbei die Wohnlichkeit bzw. den Wert des Eigenheimes. Hohe Geldstrafen bis zu 50.000 Euro drohen hingegen Eigentümern, auch Erben, die Ihr Haus nicht entsprechend umrüsten. Im Falle von Eigentümergemeinschaften werden die Kosten der Sanierungsarbeit auf Hausgemeinschaft und Privateigentümer verteilt.
Welche Maßnahmen müssen ausgeführt werden?
Das Dach / Dachgeschoss bzw. die Geschossdecke oberhalb beheizter Räume muss dem Mindestwärmeschutz entsprechen oder gedämmt werden. Dies kann in Eigenregie übernommen oder an Handwerker übertragen werden. Sorgfältige Arbeitsweise verhindert später Wärmebrücken und Bauschaden. Auch alte Heizkörper und -kessel müssen ausgewechselt werden. Die Sanierungsmaßnahmen werden mit Fördergeldern vom Staat (KfW Kredit) unterstützt. Eigentümer können bei finanziellen Engpässen eine Schonfrist von zwei Jahren in Anspruch nehmen.Es gibt einige Ausnahmen zu dieser Regelung, beispielsweise bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude. Auch Ferienhäuser, die weniger als vier Monate beheizt werden, sind oftmals ausgenommen.
Blog GEG: Was kommt nach der EnEV?
Bauphysikalische Eigenschaften der Wärmedämmung
Als Dämmstoffe gegen Aufheizung und Auskühlung des Gebäudes werden Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit eingesetzt.
Wärmeleitwert λ
Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material. Die Wärmedämmung aller bautechnisch eingesetzten Materialien beruht darauf, dass sie Luft in Poren, Zellen oder Faser-Zwischenräumen einschließt. Stehende Luft leitet Wärme in geringem Maße (0,024 λ). Denken Sie an gehärteten Schaumstoff oder natürliche Dämmstoffe aus Holz. Alle Pflanzenzellen schließen Luft ein, synthetische Dämmstoffe ahmen dieses Prinzip nach.Glas hat einen Wert von 0,76 λ; Glaswolle, also feine Glasfasern mit Luft in den Zwischenräumen, erreicht 0,04 - 0,05 λ. Und Schafwolle schneidet mit 0,035 λ noch besser ab – die Wollmütze fürs Haus.
Die Wärmeleitstufe (früher WLG, jetzt WLS) gibt die Durchlassfähigkeit eines Materials für einen Wärmestrom an. Ein brauchbarer Dämmstoff schützt vor Wärmeenergieverlust und auch vor starker Erwärmung im Sommer. Die Einstufung in WLS zeigt, wie dick die Wärmedämmung verbaut werden muss. Die Dämmstoffdicke wird vom Energieberater ermittelt, da sie von Material, Ort und Energiebedarf des Gebäudes abhängen.
Weitere entscheidende Werte sind:
- Brennbarkeit (Brandschutz)
- Formbeständigkeit (Feuchtigkeit, Temperaturschwankung, UV)
- Beständigkeit gegen Schimmel, Fäule und Insekten/Tiere
- Druckfestigkeit
- Gesundheitsrisiko durch Bestandteile und Ausgasung
- Preis (im Vergleich zur Ersparnis)
- Verfügbarkeit
- Aufnahme von Luftfeuchtigkeit / Feuchteausgleich
- Beständigkeit gegen starken Regen
- Geruch, ggf. Optik
- Verarbeitbarkeit
- Gewicht
- Zusatznutzen z.B. Schalldämmung
- nachwachsender Rohstoff
- Energieaufwand Produktion und Lieferwege
- Haltbarkeit/Lebensdauer
- Entsorgung - Zweitnutzung z.B. Kompost / Verkauf oder entstehen Kosten?
Konventionelle Dämmstoffe
Bewährte konventionelle Materialien zur Fassadendämmung sind beispielsweise Polystyrol, Mineralwolle und Schaumglas. Solche anorganischen Dämmstoffe können mineralischen Ursprungs (Glas- und Steinwolle aber auch Ton und Vulkangestein) sein oder aus Erdöl synthetisch hergestellt werden. Ein bekanntes Erdölprodukt ist expandiertes Polystyrol (EPS), Markenname Styropor.
Expandiertes Polystyrol (EPS) hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 bis 0,050 λ, ist im Einkaufspreis günstig und vielerorts in Platten zur Eigenmontage verfügbar. Es ist bei Eigentümern, die der EnEV Dämmpflicht entsprechen wollen sehr gefragt, da einfach zu verarbeiten.
Das Material ist undurchlässig für Feuchtigkeit, was sowohl Vor- als auch Nachteile birgt. Wenn sich Wasserdampf im Hausinneren staut, birgt dies ein Schimmelrisiko. Andererseits saugt sich der Schaum-Dämmstoff nicht mit Außenfeuchte und Regenwasser voll. Hier ist der Einsatzort entscheidend, in bekannten Hochwassergebieten können EPS-Platten sinnvoll angebracht werden. Zur Außendämmung ist EPS nicht unbegrenzt einsetzbar, da es mit UV-Strahlung reagiert und reißen kann.
Erwähnenswert sind die schlechten Brandschutz-Eigenschaften des Materials. Ab knapp über 100°C brennt es und setzt toxische Dämpfe frei. Die Fassade des Hochhauses Grenfell Tower in London war mit Verbundplatten mit Kunststoffkern gedämmt. Der katastrophale Brand im Juni 2017 breite sich bis zu den oberen Stockwerken an der Fassade aus und forderte 17 Tote. Flammen „klettern“ rasch empor, da schmelzendes Material heruntertropft und dem Feuer so einen Weg nach oben leitet. Dieses Ereignis weckt Skepsis gegenüber den brennbaren Dämmplatten aus Erdöl. In Deutschland wird das günstige Material, angetrieben durch die KfW-Bank Förderung zur Energiesanierung, großflächig eingesetzt. Diese Art der Dämmung ist lediglich für Hochhäuser über 22 Meter verboten.
Der Spiegel meldete bereits im Jahr 2014, Polystyrol an deutschen Hausfassaden nähme zusammengenommen eine Fläche größer als Hamburg ein. Aufgeschlüsselt entspricht das jedem zweiten Gebäude. Um die Brennbarkeit zu reduzieren, wurde den EPS-Platten das Flammschutzmittel HBCD zugegeben. Da es allerdings schwer toxische Gase bei Verbrennung freisetzt und Gewässer und Organismen nachhaltig schädigt, gilt ab 2013 ein gesetzlicher Verwendungsstopp für HBCD. Dieser, laut Europäischem Chemikalienrecht „besonders besorgniserregende Stoff wurde im Oktober 2016 zum „gefährlichen Abfall“ erklärt und musste kostenintensiv als Sondermüll entsorgt werden. Nur geeignete Verbrennungsanlagen, die der mit Sondergenehmigung durften das alte Baumaterial annehmen. Die Kosten für die Müll- und Schuttbeseitigung bei Altbausanierung stiegen enorm. Bauherren und verantwortliche Firmen sahen der Entsorgung fragend gegenüber, zuweilen gab es Entsorgungsengpässe, der mittelständische Handwerksunternehmen in der Existenz bedrohte.
Aufgrund etlicher Beschwerden dürfen durch eine Ausnahmeregelung seit August 2017 EPS Dämmstoffe wieder an Verbrennungsanlagen ohne Sondererlaubnis übergeben werden. Allerdings müssen sie streng getrennt von anderem Bauabfällen verpackt werden. Das Umweltrisiko besteht damit weiterhin und wird beim Anpreisen der Styroporplatten leider nicht erwähnt (Stand 12.09.17). Lesen Sie hierzu die Pressemitteilung des BMUB.
Styroporplatten und Umweltverträglichkeit gehen nur bei einem Thema Hand in Hand. Spechte verwechseln den hohlen Klang der WDVS Fassade mit fauligem Holz und beginnen Höhlen hinein zu hacken. Dies schadet dem Gebäude jedoch optisch, lässt Feuchtigkeit und Insekten eindringen und hebt die Wärmedämmung an der Stelle auf.
Mineralwolle aus geschmolzenem, feinfaserigen Gestein oder Glas hat eine bessere Umweltbilanz. Der größte Energiebedarf entsteht beim Schmelzen. Danach ist aber ein gut dämmendes, günstiges Material gewonnen, bei „üblichen“ Temperaturen nicht brennbar und wenig anfällig für Schimmel oder Nässe. Die Tücke liegt bei der Verarbeitung im Bau. Alte Mineralwolle mit einer Faserdicke unter 3 Mikrometern kann brechen und bildet feinen Staub. Er ist lungengängig und kann Krebs auslösen. Seit 1996 werden dickere Fasern hergestellt, die zwar bei Berührung die Haut reizen, aber unbedenklich für die Lunge sind (RAL-Gütezeichen). Schutzkleidung sollte bei Kontakt dennoch getragen werden, vor allem bei Entsorgung aus Altbauten.
Ökologische Dämmung
Strohballen oder Hanf als moderner Dämmstoff? Dies wirkt nur auf den ersten Blick kurios. Natürliche Dämmstoffe sind pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, z.B. Schafwolle, Kork, Holz, oder Flachs. Ihr Wärmeschutz entspricht den klassischen Produkten aus Erdöl oder Mineralien, Jute liegt bei 0,037-0,040 λ. Die natürlichen Fasern machen auch optisch mehr her als Styropor und Steinwolle. Auch recycelte Materialien wie Zellulose aus Altpapier hat eine gute Wärmedämmung (0,039 bis 0,045 λ). Sie ist bis 60° C temperaturbeständig. In Kombination mit einer Fassadenverkleidung ist die Brandgefahr nicht erhöht. Die Brandstoffklassen ökologischer Dämmstoffe reichen von A2 (Holzwolle) bis B2 normal entflammbar (wie Styropor). Im Vergleich zu konventionellen Rohstoffen sind Naturfasern nachwachend und haben eine ausgeglichene CO2 Bilanz. Einzig der Transport aus fernen Ländern, wie bei Kork aus Portugal, lässt den Energieverbrauch steigen. Pflanzen wie Flachs (Leinen) und Hanf sind von Natur aus recht resistent gegen Schadinsekten und können ökologisch angebaut werden. Zum Teil werden den Naturmaterialien Zusatzstoffe für Stabilität und Brandschutz beigemengt (Salze, Pflanzenstärke oder Polymere). Ist dies nicht der Fall, können Sie nach Nutzung kompostiert werden.
Naturdämmstoffe aus Zellulose werden lose zum Stopfen, für Einblasdämmung/Schüttung oder als vorgefertigte Dämmplatten angeboten.
Vorteile der ökologischen Dämmstoffe
- nachhaltig, nachwachsend
- gute Öko- und Energiebilanz
- Oft kurze Transportwege, regionaler Anbau
- geringe Wärmeleitfähigkeit
- gesundheitlich unbedenklich für Wohnen und Baumaßnamen
- Materialien aus der Region nutzbar
- Recycling von Altpapier, Nutzung von Sägespänen etc.
- z.T. schalldämmend
- akzeptable Brandklassen
- z.T. von Natur aus Schädlings- und Pilzresistent
- angenehmer Geruch (Ausnahme evtl. Kork)
- keine/kaum chemische Belastung
- griffige, wohnliche Struktur
Der Verbrauch an grauer Energie für Herstellung, Transport und Entsorgung ist bei natürlichen Dämmstoffen deutlich geringer – zeigen Sie mit Ihrer Auswahl Herz und Köpfchen für die Umwelt.
Unser Fazit:
Der erdberührte Fußbodenbereich ist recht feucht, natürliche Dämmstoffe sind dort oftmals ungeeignet. Für die sogenannte Perimeterdämmung eignen sich synthetisch oder mineralische Dämmstoffe, z.B. Schaumglas. Die anderen Hausebenen, z.B. Dach oder Innendämmung, können mit der breiten Auswahl natürlicher Materialien gestaltet werden.
Naturmaterialien wie Holz- und Zellulosefasern sind feuchtigkeitsausgleichend (kapillar aktiv). Es entsteht weniger Schimmel im Haus. Andere Dämmstoffe reagieren z.T. stärker auf Feuchtigkeit und verändern ihre Form im feuchten Zustand. Wasser hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,58 Λ, daher dämmen feuchte Materialien schlechter als trockene. Die Belastung durch Feuchtigkeit tritt ebenfalls bei Stein- und Glaswolle auf.
Bei konventionellen Dämmstoffen verhindert eine Dampfbremse/Dampfsperre aus Folie, dass Luftfeuchtigkeit aus dem Gebäude in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Folien werden zur Rauminnenseite hin an der Wärmedämmung angebracht. Alukaschierte Dämmung dient ebenfalls als konventionelle Dampfsperre. Ein Putz aus Lehm oder Kalk ist das Äquivalent für natürliche Dämmung. Welcher Dämmstoff sinnig ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten ab.
Die Anschaffungskosten für Ökodämmung ist mitunter höher als bei Polystyrol Platten oder anderem konventionellen Material. Dafür können Sie nachwachsende Rohstoffe nach Nutzungsdauer bestenfalls komplett kompostieren und zahlen keine Müllgebühren.
⮊ Wählen Sie Handwerker mit Erfahrung auf dem Gebiet der ökologischen Dämmstoffe.
Altbau dämmen oder heizen?
Zum Teil kann nachträgliche Fassadendämmung hohe Kosten verursachen, die sich im Vergleich zur Heizersparnis kaum rechnen. Vor allem der Nutzen von Dämmfolien oder aufgeklebte Dämmplatten wird von Experten oftmals kritisch bewertet. Nach ausführlicher Kalkulation durch unabhängigen Energieberater, mit Berücksichtigung von Wiederverkaufswert etc., kann die Entscheidung fürs Heizen rein wirtschaftlich betrachtet günstiger sein als die Wärmedämmung. Um Kohlendioxidemissionen zu senden, muss aber auch ökologisch gedacht werden. Eine effektive (neue) Heizanlage, z.B. der Pelletofen kann eine Alternative zur Altbau-Dämmung sein.
Wussten Sie schon?
Eine Möglichkeit trotz mangelhafter Dämmung Heizkosten zu reduzieren, ist ein Deckenventilator im Wintermodus. Vor allem in Altbauten mit hohen Decken steigt erwärmte Heizungsluft nach oben, der Fußboden kühlt aus. Durch die zugluftfreie Ventilation der Luftschichten, wird die Temperatur ausgeglichen und Wärme optimal verteilt.
Die Kosten für einen Ventilator und seine Installation sind vergleichsweise gering. Gleichstrom-Ventilatoren verrauchen je nach Betriebsstufe ca. 3 bis 35 Watt. Die Geräte sind oftmals wartungsfrei und mit einer Motorgarantie bis zu 25 Jahre ausgestattet. Zudem können Deckenlüfter meist zur Beleuchtung eingesetzt werden.
Quellen:
https://baustoffe.fnr.de/
https://www.sanier.de/daemmung/daemmstoffe/natuerliche-daemmstoffe
https://www.thermondo.de/info/rat/heizen/mythen-waermedaemmung/
Bildquellen:
Blogbanner Thermostat, Urheber: ri, CC0 Creative Commons, pixabay.com
Haus mit Mütze, Urheber: exclusive-design, fotolia.com
Materialien, Urheber: Ingo Bartussek, fotolia.com
Heizung, Urheber: Andrey Popov, fotolia.com
Energieberatung, Urheber: Unbreakable, fotolia.com
Fassadendämmung, Urheber: schulzfoto, fotolia.com
Mineralwolle, Urheber: Tomasz Zajda, fotolia.com


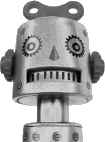








 YouTube
YouTube Instagram
Instagram